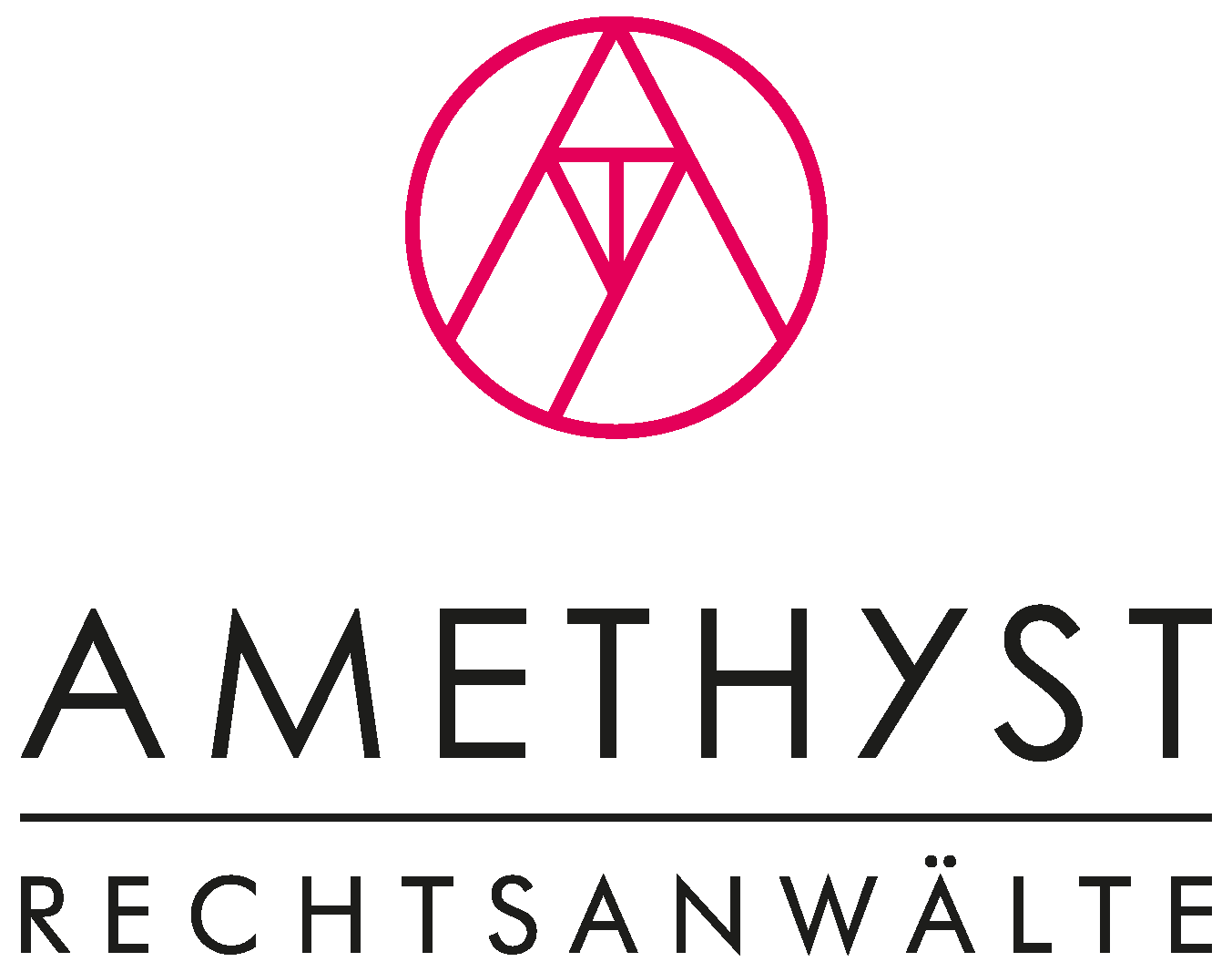Bedeutung der drittschützenden Normen beim Vorgehen gegen Baugenehmigungen
Bedeutung der drittschützenden Normen beim Vorgehen gegen Baugenehmigungen
Bedeutung der drittschützenden Normen beim Vorgehen gegen Baugenehmigungen
- Kategorie: Immissionsrecht
Anwohner können eine Genehmigung von Windenergieanlagen nicht dadurch beseitigen, dass sie sich auf Abstandsregelung nach dem Landesentwicklungsprogramm berufen. Denn diese entfalten keinen Drittschutz. Das und Weiteres hat das OVG Rheinland-Pfalz mit seinem Urteil vom 31.03.2021 (Az. 1 A 10858/20) klargestellt.
Im konkreten Fall ging ein Anwohner gerichtlich gegen die Genehmigung zur Errichtung von Windenergieanlagen vor, da von deren Größe und Lage eine optisch bedrängende Wirkung ausginge. Er stufte den von ihnen ausgehenden Lärm und Schatten als unzumutbare Beeinträchtigung ein. Auch die allgemeinen Vorprüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) seien seiner Auffassung nach nicht ausreichend gewesen, sondern mangelhaft und unvollständig. Darüber hinaus beschwerte er sich darüber, dass die festgelegten Mindestabstände von 1.100 m zur Wohnbebauung nicht eingehalten würden. Diese seien aber im Ziel Z 163 h des Landesentwicklungsprogramms in der Fassung der Dritten Teilfortschreibung – LEP IV – festgelegt.
Er klagte, doch das Gericht entschied gegen ihn.
Keine drittschützende Norm nach dem Landesentwicklungsprogramm
Eine der Vorschriften nach dem Ziel Z 163 h des Landesentwicklungsprogramms, auf die sich der Kläger berufen wollte, lautete:
Bei der Errichtung von Windenergieanlagen ist ein Mindestabstand dieser Anlagen von mindestens 1.000 Metern zu reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Misch- und Kerngebieten einzuhalten. Beträgt die Gesamthöhe dieser Anlagen mehr als 200 Meter, ist ein Mindestabstand von 1.100 Metern zu den vorgenannten Gebieten einzuhalten.
Doch auf diese Vorschrift könne sich der Kläger gar nicht berufen, weil sie ihn nicht schützt, stellte das Gericht fest. Die Ziele der Raumordnung entfalten gegenüber privaten Grundstückseigentümern grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtswirkungen. Sie dienen allein den öffentlichen Stellen, die sie bei ihren Planungen zu beachten hätten. Private Grundstückseigentümer können hieraus weder Rechte noch Pflichten für sich ableiten, so das Gericht.
Abwägung öffentlicher und privater (Gruppen-)Belange (§ 7 Abs. 2 ROG)
Wenn Raumordnungspläne aufgestellt werden, seien zwar öffentliche und private Belange gegeneinander abzuwägen (§ 7 Abs. 2 ROG). Private Belange seien insofern aber nur als „Gruppenbelange“, in pauschaler, typisierender Art und Weise zu berücksichtigen, nicht im gänzlich individuellen Ausmaß.
Auch keine anderen Rechtsverletzungen erkennbar
Entgegen der Ansicht des Klägers stellte das Gericht zudem klar, dass hier auch keine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) anstelle der allgemeinen Vorprüfung hätte erfolgen müssen. Eine solche sei nur notwendig, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
1. Es muss sich um mehrere Vorhaben derselben Art handeln, die
2. in einem engen Zusammenhang stehen (kumulierende Vorhaben),
3. gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und
4. zusammen die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte – hier den Wert 6 bis weniger als 20 Anlagen – erreichen oder überschreiten.
Diese Voraussetzungen lagen jedoch im Fall, mit dem sich das Gericht auseinanderzusetzen hatte, nicht vor.
Auch im weiteren Vorbringen des Klägers, u.a. bzgl. des Schattenwurfs, potentieller Lärmbeeinträchtigungen sowie einer allgemein optisch bedrängenden Wirkung durch die Windenergieanlagen sah das Gericht keine unzumutbaren Belästigungen und wies diese allesamt zurück. Bzgl. der optisch bedrängenden Wirkung verdeutlichte das OVG, dass eine solche regelmäßig jedenfalls nicht angenommen werden kann, wenn der Abstand zwischen einem Wohnhaus und Windenergieanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + ½ Rotordurchmesser) beträgt, was vorliegend der Fall war. Auch eine Einzelfallprüfung konnte hier zu keinem anderen Ergebnis führen.
Damit muss der Kläger die Windenergieanlagen akzeptieren.
AMETHYST - Tipp
Der erfolgreiche Schutz im Immissions- und Emissionsrecht sowie im allgemeinen Öffentlichen Baurecht gegen Bauvorhaben steht und fällt in der Regel mit dem Bestehen nachbar- bzw. drittschützender Normen. Im vorliegenden Fall ist die Klage gerade am Fehlen dieser gescheitert. Das lässt sich vermeiden, durch eine sorgfältige rechtliche Prüfung im Vorhinein. Wir von AMETHYST Rechtsanwälte helfen gerne aus.
Kommentar von:

Partneranwältin bei AMETHYST Rechtsanwälte