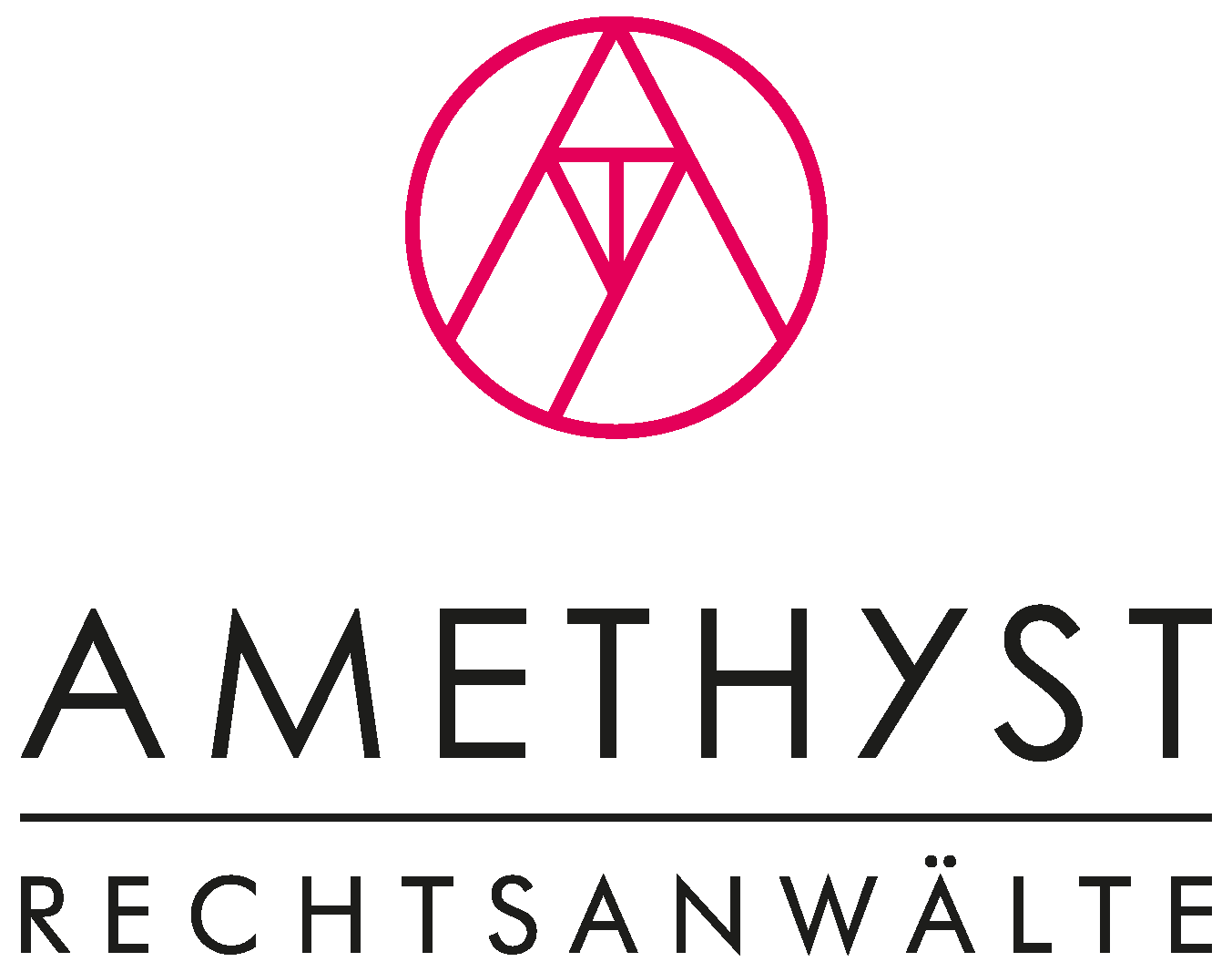Grundwasserentnahme: Rechtsverletzung durch wasserrechtliche Bewilligung?
Grundwasserentnahme: Rechtsverletzung durch wasserrechtliche Bewilligung?
Grundwasserentnahme: Rechtsverletzung durch wasserrechtliche Bewilligung?
- Kategorie: Wasserschutzrecht
Um sich gegen eine wasserrechtliche Bewilligung erfolgreich zu wehren, bedarf es einer entsprechenden Rechtsverletzung zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses. Eine mögliche Rechtsverletzung in der vagen Zukunft genügt hierfür nicht. Das entschied das VG Arnsberg in seinem Urteil vom 06.07.2018 (Az. 12 K 399/15).
Mehrere Unternehmen der Steinindustrie gingen gerichtlich gegen eine wasserrechtliche Bewilligung eines Trinkwasserbetreibers vor. Dieser betrieb seit den 1930er-Jahren die Trinkwasserversorgung mehrerer Kommunen aus einer Quelle. Hierfür wurde ihm im Jahre 1995 bis Dezember 2025 befristet, erstmals die Grundwasserentnahme aus besagter Quelle in erweitertem Umfang genehmigt, da die vorgesehene Entnahmemenge wegen steigender Wasserbedarfsmengen nicht mehr ausreichte. Mit Änderungsbescheid vom 13. Januar 2015 wurde die wasserrechtliche Bewilligung zur Grundwasserentnahme sodann auf das Jahr 2044 hinaus verlängert. Genau daran störten sich jedoch die Steinbauunternehmen, weil sie sich dadurch in der Qualität des Steinabbaus beeinträchtigt sahen.
Gefährdung des Steinabbaus durch zeitliche Verlängerung einer wasserrechtlichen Bewilligung?
Konkret befürchteten sie u.a., dass ihre bergrechtlichen Bewilligungen bzw. ihr Bergwerkseigentum durch die Gewässerbenutzung beeinträchtigt werden könnte, und insbesondere zu einer Änderung ihrer Abbaubereiche – etwa durch den Anstieg des Grundwassers oder veränderten Grundwasserverlauf – führen könne. Dadurch könnten heute zulässige Trockenabbaumaßnahmen künftig nicht mehr zulässig, erschwert oder verteuert werden. Es läge somit eine Beeinträchtigung eines Rechts i.S.d. § 14 Abs. 3 WHG vor. Mit Blick auf die geplanten Nassabgrabungen der Steinindustrie, welche wegen fehlender anderweitiger Erweiterungsmöglichkeiten des Steinabbaus wohl noch vor 2044 betrieben werden müssten, verstoße die Bewilligung schließlich gegen das wasserrechtliche Gebot der Rücksichtnahme. Denn die Belange der Steinindustrie hätten vor Erteilung der Bewilligung berücksichtigt werden müssen.
Nicht jede bauliche Änderung führt zur Rechtswidrigkeit
Doch das Verwaltungsgericht stellte klar: Entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Bewilligungsbescheides sei die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seines Erlasses. Zu diesem Zeitpunkt seien hier jedoch keine entsprechenden Rechtsverletzungen ersichtlich.
Es führte u.a. aus: Nicht jede bauliche Veränderung einer Gewässerbenutzungsanlage führe zur Rechtswidrigkeit der Anlage. Dies gilt gerade dann, wenn die Änderungen im Wesentlichen den Nutzungsumfang betreffen, ohne dass das technische Konzept der Gewässerbenutzung bzw. deren Zweck grundlegend geändert wurde. Denn bei einer solchen Änderung kann nicht damit gerechnet werden, dass das Interesse an der Ausnutzung des ursprünglich erteilten Rechts erloschen ist. Dies läge etwa anders, wenn die Gewässerbenutzungsanlage entfernt, aufgegeben oder elementar umgestaltet würde. Denn dann könne nicht mehr davon ausgegangen werden, dass das alte Recht in der Weise wie vor der Veränderung ausgeübt würde. Die hier in Rede stehenden Änderungen führen jedenfalls nicht zu Rechtswidrigkeit der Anlage.
Für Verstoß gegen § 14 Abs. 3 WHG müssen Nachteile überwiegend wahrscheinlich sein
Auch sei ein Verstoß gegen § 14 Abs. 3 WHG nicht ersichtlich, da nicht zu erwarten sei, dass sich die Gewässerbenutzung nachteilig auf die Rechte der Steinbauunternehmen auswirke. Denn solche Nachteile müssten überwiegend wahrscheinlich, nicht bloß möglich sein. Darüber hinaus müsste die Gewässerbenutzung unmittelbar auf Betroffenenrechte einwirken. Beides sei hier jedoch zu verneinen, so das Gericht.
Ganz im Gegenteil sah das Gericht in der erteilten Bewilligung sogar einen Vorteil für den Steinabbau. So würde die bisherige Grundwasserentnahme in der Menge (lediglich) fortgeführt und damit sogar den Fortbestand des bisherigen Trockenabbaus der Steinbauindustrie fördern. Ein Grundwasseranstieg sei nicht zu erwarten. Selbst wenn man von möglichen Erschwerungen des geplanten Nassabbaus ausgehen würde, sei eine Rechtsverletzung i.S.d. § 14 Abs. 3WHG hier nicht annehmbar. Die vorgetragenen potenziellen Nachteile seien keine unmittelbaren Folgen der Grundwasserentnahme, sondern würden allenfalls– mit Blick auf die Quantität bzw. Qualität des gewonnenen Trinkwassers – erst mittelbar durch künftige Genehmigungsverfahren zur Zulassung von Nassabgrabungen in Form von behördlichen Versagungen oder Auflagen eintreten.
Kein Verstoß gegen wasserrechtliches Rücksichtnahmegebot
So mussten hier auch keine näheren Erhebungen dazu angestellt werden, in welchem Umfang und wann der künftige Nassabbau stattfinden sollte. I.d.S. fehle es bereits an konkreten Planungen seitens der Steinbauunternehmen, ab welchem Zeitpunkt und wo genau künftige Nassabgrabungen stattfinden sollten. Die vage Angabe, mit der Tieferlegung bereits „vor 2044“ beginnen zu wollen genüge diesbezüglich nicht.
Ohnehin komme der Grundwasserentnahme zur öffentlichen Wasserversorgung ein besonderer Schutz zu, der entsprechender Abbautätigkeit vorgehe.
AMETHYST Rechtsanwälte - Tipp
Diese Entscheidung zeigt mal wieder: Die Beurteilung der Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit einer wasserrechtlichen Bewilligung kann durchaus von komplizierter und umfangreicher Natur sein. Wir von AMETHYST Rechtsanwälte unterstützen Sie hierbei gerne.
Kommentar von:

Partneranwältin bei AMETHYST Rechtsanwälte